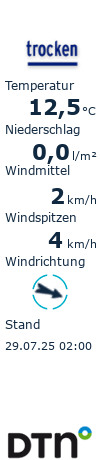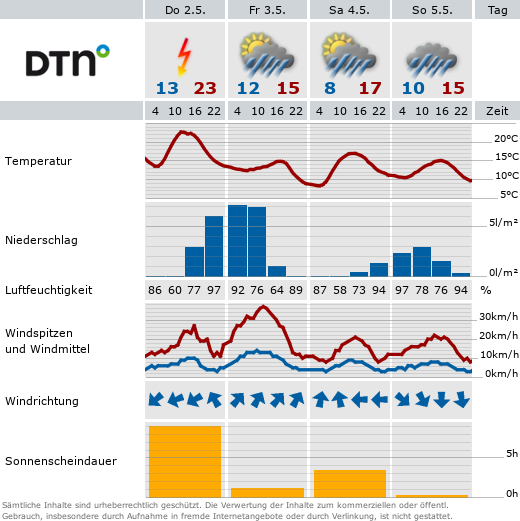Abgeschlossene Forschungsprojekte
Modellvorhaben der Raumordnung: Berücksichtigung der Kulturlandschaftsentwicklung in Flussgebieten unter dem Aspekt des Hochwasserschutzes
Details zu diesem Forschungsprojekt finden Sie auf der Projektwebsite des Bundesamtes für Bauwesen und Raumordnung (BBR).

Akustische Charakterisierung von potentiellen ruhigen Gebieten in Dortmund
Die Stadt Dortmund und die TU Dortmund arbeiten gemeinsam an einem innovativen Forschungsprojekt, das auf die Charakterisierung von vorgeschlagenen ruhigen Gebieten in Dortmund abzielt. Das Forschungsprojekt unterstützt das formale Instrument "Lärmaktionsplan", das für alle städtischen Regionen durch EU-Recht vorgeschrieben und im deutschen Raumplanungssystem durch das Bundesimmissionsschutzgesetz (BImSchG §47) verankert ist.
Planning in Germany and Pakistan
The project “Planning in Germany and Pakistan: Responding Challenges of Climate Change through Intercultural Dialogue” aims to start and stimulate dialogue between the students and young academics from Germany and the higher education institutes in Pakistan. It targets modernization of teaching, promotion of skill development of young academics, identification of teaching and research areas of shared scientific interest, and establishing networks and cooperation regionally and internationally.
RESI und BSF
Im Zentrum der vom DAAD geförderten Hochschulkooperation steht das Anliegen die Universität Mosul in Krisenzeiten dabei unterstützen, in Lehre und Forschung internationale Anschlussfähigkeit sicherzustellen, Strategien für die Zeit nach der Krise zu entwickeln und interdisziplinäre Zusammenarbeit und Netzwerkbildung zu befördern, um Voraussetzungen für den Aufbau einer längerfristigen Partnerschaft zu schaffen.
Visuelle Auswirkungen des geplanten Windparks Wullersdorf
Mit unserer Forschung möchten wir herausfinden, ob sich Windenergieanlagen in bestimmten Landschaftstypen eher stärker (oder schwächer) auf das Landschaftsbild auswirken, und ob die unterschiedliche Präferenz ggf. auf unterschiedliche soziodemographischen Gruppen (unterschiedliche/s Geschlecht, Alter, Bildung, Ethnie etc.) zurückgeführt werden kann.

DAZWISCHEN
Das vom BMBF geförderte Forschungsprojekt DAZWISCHEN befasst sich mit dem Strukturwandel im Rheinischen Revier, welches sich zwischen der Rheinschiene (Düsseldorf, Köln, Bonn) im Osten und der Grenzregion um Aachen im Westen befindet und wird von Prof. Dr. Stefan Greiving (TU Dortmund, IRPUD) geleitet.
Planung in Deutschland und im Iran: Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels durch interkulturellen Dialog
Das Projekt „Planung in Deutschland und im Iran: Bewältigung der Herausforderungen des Klimawandels durch interkulturellen Dialog“ ist ein vom DAAD gefördertes Forschungsprojekt zwischen der Fakultät für Raumplanung der TU Dortmund und dem Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institue (DHEI) in Esfahan, Iran.
Planning in Germany and Iran: Responding Challenges of Climate Change through Intercultural Dialogue
The project “Planning in Germany and Iran: Responding Challenges of Climate Change through Intercultural Dialogue” is a DAAD funded research project between the School of Spatial Planning at TU Dortmund University and Daneshpajoohan Pishro Higher Education Institue (DHEI) of Esfahan, Iran.
Akustische Qualität und Gesundheit in Urbanen Räume
Die Geräuschkulisse ist seit Jahren ein Thema der Stadtentwicklung. Im Kontext der Gesundheitsforschung wurde sie allerdings bisher auf den Risikofaktor Lärm beschränkt. Klanglandschaften (Soundscapes) umfassen dagegen alle hörbaren Klänge: natürliche, menschliche, technische und musikalische. In einem von MERCUR geförderten Projekt analysieren das Zentrum für urbane Epidemiologie des Uniklinikums Essen und die Raumplanung der Technischen Universität Dortmund, wie Soundscapes und Gesundheit im Ruhrgebiet zusammenhängen.
ZUKUR - Zukunft - Stadt - Region - Ruhr
Ziel des BMBF-geförderten Projekts „Zukunft-Stadt-Region-Ruhr“ (ZUKUR) ist es, sowohl Beitrage zur Erhöhung der Klimaresilienz als auch zum Abbau sozio-ökologischer Ungleichheit für die Stadt-Region Ruhr zu erarbeiten. Es sollen im Rahmen von Reallaboren auf Regional-, Stadt- und Quartiersebene bestehende und künftige Herausforderungen in der Stadtregion Ruhr identifiziert und Lösungen zum Umgang mit künftigen Klimafolgen und sozio-ökologischen Ungleichheiten erarbeiten werden.
Projekt PLIQ
Die Fakultät Raumplanung der TU Dortmund wurde beauftragt, Lehrinhalte sowie Forschungskonzepte aus dem Bereich Raumplanung zu entwickeln und in den irakischen Universitäten zu implementieren. Seit 2014 ist das Projekt am Lehrstuhl LLP angesiedelt (Projektkoordinator: Dr. Hasan Sinemillioglu; Projektleiter: Univ.-Prof. Dr. Dietwald Gruehn).
Visualisierung von Landschaftsbildveränderungen durch Kraftwerke
Als Grundlage für die Standortplanung für Windkraftanlagen im regionalen Flächennutzungs-
plan und um hinsichtlich des Schutzgutes Landschaft/Landschaftsbild für weitere Planungsvor-
haben eine aktuelle und valide Datengrundlage zu haben, hat der Regionalverband Saarbrücken
ein Forschungsvorhaben an der TU Dortmund zur GIS-gestützten Landschaftsbildanalyse und
-bewertung mit Konfliktuntersuchung zu potenziellen Vorrangflächen für Windkraftanlagen fi-
nanziell mit einer Zuwendung unterstützt.
Geplante Kraftwerke an mehreren Standorten in Deutschland werden nach einer einheitlichen Methodik visualisiert, um die Auswirkungen auf das Landschaftsbild beurteilen zu können.
Klimawandelgerechte Stadtentwicklung – Ursachen und Folgen des Klimawandels durch urbane Konzepte begegnen
Ab Ende 2009 sollen in Modellvorhaben urbane Konzepte zum Klimawandel erprobt werden. In der ExWoSt-Vorstudie wird ein integriertes "Kommunales Strategie- und Aktionsset Klimawandel" in Form eines Entscheidungsunterstützungstools vorbereitet und in Testkommunen erprobt. Die wesentlichen Aufgaben- und Aktivitätsbereiche zu Klimaschutz und Klimaanpassung werden in vorgeschalteten Expertisen erarbeitet.
Details zu diesem Forschungsprojekt finden Sie auf der Projektwebsite des Bundesinstitutes Für Bau, Stadt- und Raumforschung (BBSR).
Naturschutz in der Stadt – Nachhaltige Verbesserung seiner Implementationsbedingungen durch Schaffung von Naturerlebnismöglichkeiten für Kinder und Jugendliche – am Beispiel der Stadt Dortmund
Dieses, von der Dr. Gustav Bauckloh-Stiftung, Dortmund, geförderte Forschungs- und Entwicklungsvorhaben soll anknüpfend an die historische Entwicklung des Naturschutzes, die gesetzlich definierten Ziele und Aufgaben des Naturschutzes (und der Landschaftspflege), die Erkenntnis, dass trotz Einführung einer Vielzahl naturschutzrechtlicher Instrumente und vergleichsweise weit reichender Bemühungen des amtlichen und ehrenamtlichen Naturschutzes dem Rückgang der biologischen Vielfalt, insbesondere in Deutschland, nicht Einhalt geboten werden konnte, sowie erste empirisch abgesicherte Kenntnisse über den Erfahrungs- und Lernprozess von Kindern und Jugendlichen im Umgang mit der Natur, welcher nicht nur positive Wirkungen für die kognitive Entwicklung von Kindern und Jugendlichen belegt, sondern auch längerfristige Unterschiede im Verhalten gegenüber Natur und Umwelt determiniert, ein innovatives Konzept am Beispiel und mit Unterstützung der Stadt Dortmund erarbeitet werden, mit dem die Rahmen- und Umsetzungsbedingungen für den Naturschutz in der Stadt nachhaltig verbessert werden können. Projektpartner sind die WWU Münster, Fachgebiet Erziehungswissenschaften, Schwerpunkt Schultheorie und -forschung, sowie das Umweltamt der Stadt Dortmund.
Prototypische Auswirkungen politischer Maßnahmen auf multifunktionale Aktivitäten ländlicher Gemeinden (PRIMA)
Bei dem Forschungsprojekt "PRIMA" handelt es sich um ein von der EU gefördertes Projekt des 7. Forschungsrahmenprogramms. Ziel des Projektes ist es, Downscaling-Methoden zu entwickeln, mit deren Hilfe die Auswirkungen unterschiedlicher EU-Politiken auf regionaler und lokaler Ebene für multifunktionale Landnutzungen und ökonomische Aktivitäten analysiert werden können. Projekt-Koordinator ist das CEMAGREF (Centre national du machinisme agricole, du génie rural, des eaux et des forêts, France). Es sind 11 wissenschaftliche Institutionen aus 8 verschiedenen europäischen Ländern beteiligt.
Techniken zur multifunktionalen Bewertung von Auswirkungen globaler Umweltveränderungen auf Landnutzungssysteme (Region Xinjiang/China)
Ziel dieses vom Bundesministeriums für Bildung und Forschung geförderten Projektes ist es, den Wissenstransfer zwischen dem Lehrstuhl Landschaftsökologie und Landschaftsplanung der Technischen Universität Dortmund und dem Xinjiang Institute of Ecology and Geography, Urumqi/China, im Bereich der Ermittlung von Auswirkungen globaler Veränderungen auf Landnutzungssysteme zu stärken. Hauptaugenmerk liegt dabei auf der Anwendung multikriterieller Verfahren zur Bewertung der Wechselwirkungen zwischen Landnutzungssystemen, Wassermanagement und Desertifikationserscheinungen in der Region Xinjiang. Die entwickelten Erkenntnisse sollen dazu dienen, die nachhaltige Nutzbarkeit der natürlichen Ressourcen wie z.B. dem Trinkwasser sicherzustellen.
Europäische Kultur in Agrarlandschaften (EucaLand)
Das Projekt "European Culture expressed in Agricultural Landscapes" (EucaLand) wird von der EU im Programm "Culture 2007-2013" gefördert. 42 Partner-Institutionen aus 27 Ländern sind an dem Projekt beteiligt und befassen sich mit der Frage, wie Agrarlandschaften aus kulturlandschaftlicher Sicht beschrieben, klassifiziert, bewertet und entwickelt werden können.
Methoden-Hauptstudie für eine flächendeckende Landschaftsbildanalyse und -bewertung in Mecklenburg-Vorpommern
Die Methoden-Hauptstudie für eine flächendeckende Landschaftsbildanalyse und -bewertung in Mecklenburg-Vorpommern als Beitrag zum Gutachtlichen Landschaftsprogramm sowie zur Fortschreibung des Moorschutzkonzeptes wird im Auftrag des Ministeriums für Landwirtschaft, Umwelt und Verbraucherschutz Mecklenburg-Vorpommern erarbeitet.
Publikation:
Gruehn, D. & Roth, M. (2008): Methoden-Vorstudie für eine flächendeckende Landschaftsbildanalyse und –bewertung in Mecklenburg-Vorpommern als Beitrag zum Gutachtlichen Landschaftsprogramm sowie zur Fortschreibung des Moorschutzkonzeptes. LLP-report 005. Dortmund. 27 S.
Entwicklung eines urbanen Biotopverbundes im Rahmen des Freiraumkonzeptes Metropole Ruhr
Der Regionalverband Ruhr (RVR) bereitet derzeit die Erarbeitung eines "Freiraumkonzeptes Metropole Ruhr" für sein Verbandsgebiet mit einem Schwerpunkt im "Entwicklungsraum Stadtlandschaft" vor. Das Forschungsprojekt dient der wissenschaftlichen Begleitung dieses Planungsprozesses sowie der Entwicklung von innovativen planerischen Konzepten und Instrumenten zu Fragen des urbanen Freiraum- und Biotopverbundes. Den Freiraumansprüchen der Bevölkerung wird hierbei besondere Aufmerksamkeit gewidmet.